Projekt „Schule im Wandel“ (SchiWa)
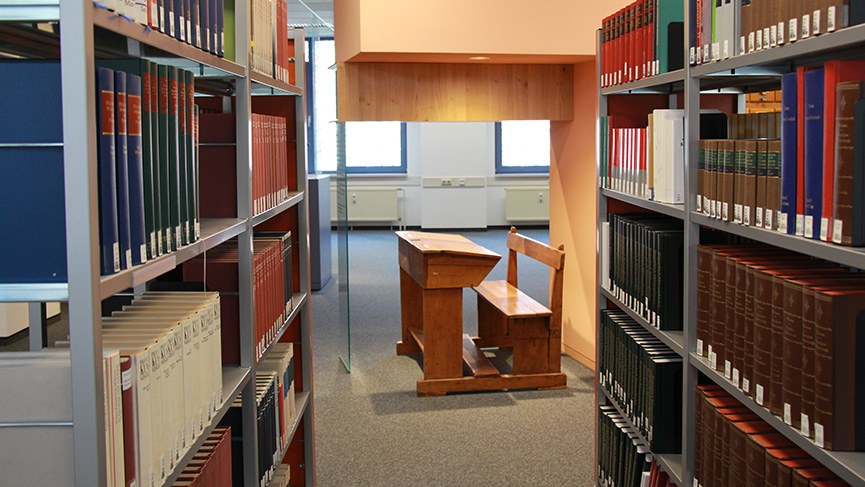
Das von der DFG geförderte Projekt „SchiWa“ untersucht, ob und in welcher Weise sich Schul- und Unterrichtskulturen zwischen den 1970er und den 2020er Jahren verändert haben. Während es viele Annahmen zu diesem Wandel gibt, mangelt es bislang an empirisch abgesichertem Wissen. Diese Lücke will das Projekt schließen, indem es pädagogische Werte und Normen von Lehrenden, die Vorstellungen von Schüler*innen und die Ausgestaltung von Unterricht und Schulleben in diesem Zeitraum erforscht. Das interdisziplinäre Projekt verbindet dazu die empirisch-quantitative mit der historischen Bildungsforschung. Neben der BBF sind auch die Abteilung „Lehr- und Lernqualität in Bildungseinrichtungen“ (LLiB) des DIPF sowie die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz an dem Vorhaben beteiligt.
Ausgangspunkt der Analyse ist die sogenannte „Drei-Länder-Studie“ von Prof. Dr. Helmut Fend, die 1978/79 an Gesamtschulen in Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen durchgeführt wurde. SchiWa vergleicht deren Daten mit den Befunden einer im Projektzusammenhang 2023 organisierten Follow-up-Studie. Die quantitativ-empirischen Daten belegen einen Wandel der Schul- und Unterrichtskulturen zwischen damals und heute. Die Aufgabe der BBF besteht darin, diese Befunde in schulgeschichtlichen Fallstudien zu konkretisieren, historisch zu kontextualisieren und in die Zeitgeschichte „nach dem Boom“ einzuordnen, also in der Zeit nach Ende des wirtschaftlichen Aufschwungs seit Ende der 1970er Jahre.
Das BBF-Team wählte für seine Arbeit vier Schulen aus, die an beiden Studien (1978/79 und 2023) teilgenommen haben – jeweils ein Gymnasium und eine Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. An ihnen soll exemplarisch der historische Wandel für unterschiedliche Länder, Regionen und Schulformen nachgezeichnet werden. Das Material, das teils in den Schulen selbst, teils in Archiven ermittelt wurde, umfasst unterschiedliche Quellenarten. Dazu zählen Veröffentlichungen wie Jubiläumsfestschriften, Jahrbücher und Presseberichte, aber auch Archivalien wie Protokolle von Schul- und Lehrkräftekonferenzen, Fotosammlungen, Abituransprachen, Schüler*innenakten, schulische Schriftwechsel mit Eltern und Behörden, Gästebücher und Schulqualitätsberichte. Ergänzt wird das Material durch bislang sieben Zeitzeug*innen-Interviews mit Lehrkräften. Diese waren lange Jahre an den Schulen tätig und schilderten dem Projektteam in jeweils etwa zweistündigen Interviews ihre individuellen Erfahrungen mit den Schulveränderungen.
Auf der Basis dieses Materials konnten die Forschenden erste Thesen zu den Wandlungsprozessen in den 1970er, 1980er und 1990er Jahren formulieren:
- Die 1970er Jahre waren eine Phase beschleunigten schulkulturellen Wandels. So liberalisierte sich etwa das Verhältnis zwischen Schüler*innen und Lehrkräften.
- Die 1980er Jahre waren nach dem Ende der Bildungsreform-Ära ein Jahrzehnt des Übergangs: von gesellschaftsstrukturellen Reformperspektiven hin zu Projekten innerer Schulreform. Damit verbunden war eine Verlagerung von Verantwortung, eine Responsibilisierung der schulischen Akteur*innen vor Ort. Diese wurden nun dafür verantwortlich gemacht, dass sich die pädagogische Arbeit an den einzelnen Schulen, ihre „Qualitiät“ verbesserte. Dabei mussten sie mit der Ressourcenknappheit der öffentlichen Hand umgehen.
- Ab Mitte der 1990er Jahre erweiterte sich die Zuständigkeit der Einzelschulen noch einmal. Mit den damals eingeführten internationalen Vergleichsstudien mussten sie sich zunehmend auch standardisierten Leistungsmessungen stellen und wurden nach den dabei angelegten Maßstäben bewertet.
Mit der bildungshistorischen Interpretation empirisch-quantitativer Daten haben die Forschenden auch theoretisch-methodologisch Neuland betreten. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit hat sich dabei als besondere Chance erwiesen: Das Team konnte das Wissen über schulkulturelle Transformationen im Kontext gesellschaftlichen Wandels auf breiterer Quellengrundlage absichern und erweitern. Damit ist die Basis gelegt, um die Erkenntnisse zu schulgeschichtlichen Entwicklungsprozessen bis in die unmittelbare Gegenwart hinein weiter fortzuschreiben.
Literatur
Kurig, J. (2024). ‚Sensibilität‘ und ‚Solidarität‘: Das Konzept ‚Sozialen Lernens‘ und die Gefühlskultur der Gesamtschule der 1970er und 1980er Jahre. Jahrbuch für Historische Bildungsforschung, 30, 159-180. doi:25658/bx80-0t93